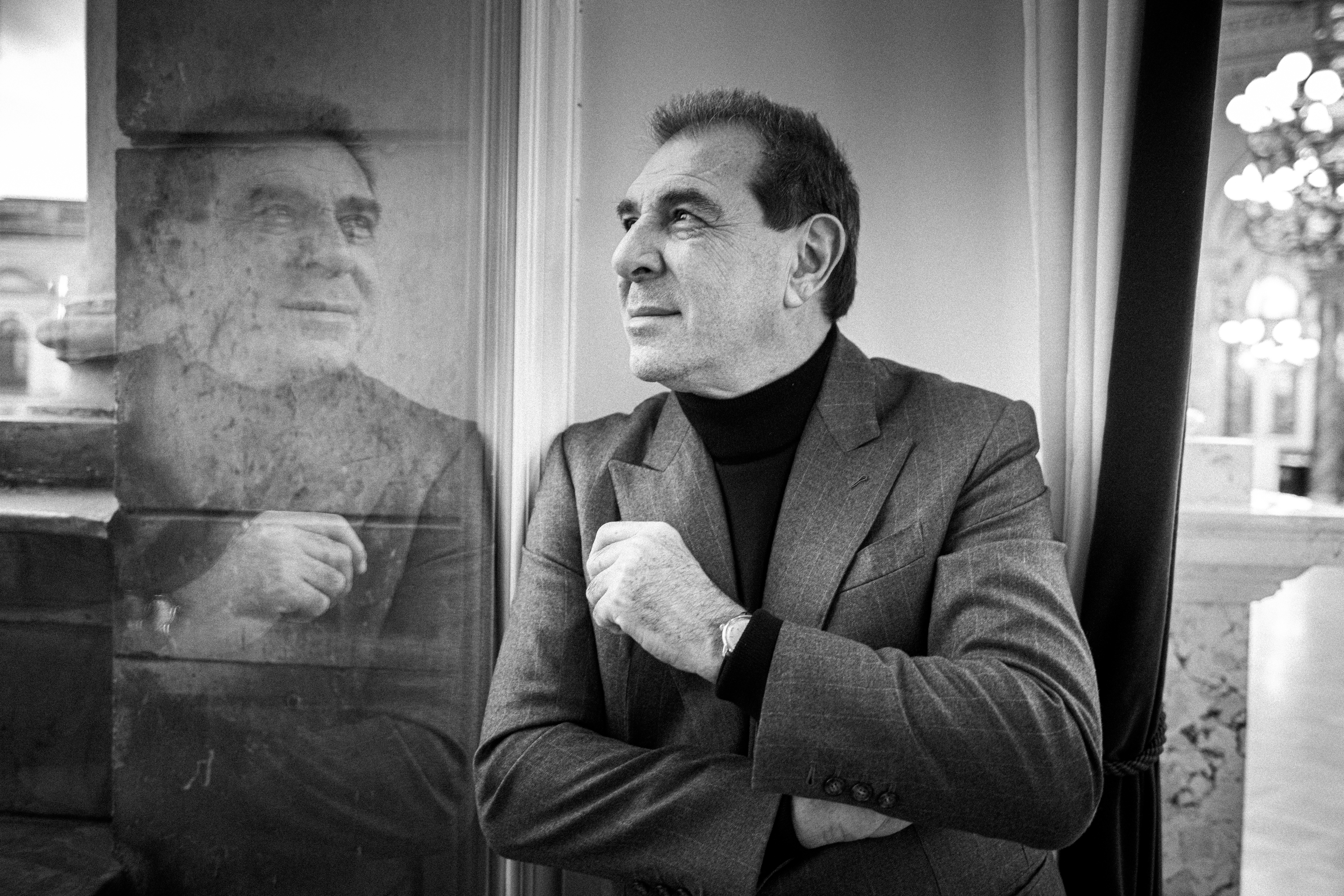Fortsetzung des Mahler-Zyklus`
Daniele Gatti und Gustav Mahler
In seiner zweiten Saison als Chefdirigent der Staatskapelle Dresden setzt Daniele Gatti den Maher-Zyklus mit den sogenannten »Wiener Jahren« fort. Im Interview mit Michael Ernst blickt er auf die kommende Spielzeit, in der er Verdis »Falstaff« und Wagners »Parsifal« leiten wird.
Maestro Gatti, Ihre erste Saison als Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle ist vorbei, wagen wir einen Blick zurück: Wie war Ihr Start und wie bilanzieren Sie die ersten Monate in Dresden?
Daniele Gatti: Ich bin sehr glücklich, in Dresden bei einem der bedeutendsten Orchester der deutschen Tradition und zugleich einem der größten Orchester der Welt zu sein. Wir haben im September gemeinsam diesen langen Weg begonnen, und es freut mich sehr, dass mein erstes großes Projekt für diese Stadt ein dreijähriger Mahler-Zyklus ist – eine vollständige Aufführung aller Sinfonien und Lieder Gustav Mahlers. In der Geschichte der Staatskapelle wurde dieser Zyklus noch nie in Gänze aufgeführt, was aus meiner Sicht besonders hervorzuheben ist. Ansonsten arbeiten wir mit großem Engagement und sind auf einem sehr guten Weg. Aber nach sechs Monaten eine Bilanz zu ziehen, wäre verfrüht. Vielmehr geht es darum, unser Bestes für das Dresdner Publikum zu geben, das uns so herzlich aufnimmt.
Apropos Mahler, Sie haben einen Mahler-Zyklus begonnen und das Publikum insbesondere mit Ihrer Interpretation des Verdi-Requiems zum Dresdner Gedenktag stark beeindruckt. Zufrieden mit dieser Resonanz?
DG: Ja, ich bin sehr glücklich über die Wärme und Begeisterung des Publikums. Als Musiker geht es uns nicht einfach um eine Darbietung, sondern darum, eine musikalische Idee, eine Interpretation zu vermitteln. Es macht uns glücklich, wenn das Publikum die Entwicklung unserer Interpretation mitverfolgt und es macht uns noch glücklicher, wenn es auch neue Impulse aufnehmen und schätzen kann.
Der Mahler-Zyklus geht weiter, nun mit dem Schwerpunkt auf die Wiener Jahre. Welche Höhepunkte setzen Sie in der Spielzeit 2025/26?
DG: Ja, wir konzentrieren uns auf die mittleren, sogenannten Wiener Sinfonien, also jene Werke, die Mahler während seiner Zeit als Direktor der Wiener Hofoper komponierte: die 5., 6. und 7. Sinfonie. In dieser Phase entfernte er sich von der Welt des Wunderhorn und wandte sich der Suche nach einer absoluten, rein instrumentalen Musik zu. Diese drei Sinfonien stehen eingebettet zwischen der Vierten, die eine Sopranstimme verwendet, und der Achten, die von Chor und Solisten getragen wird. Ergänzend dazu werden wir die in dieser Zeit entstandenen Rückert-Lieder und die Kindertotenlieder aufführen. Der Zyklus wird in der Saison 2026/27 mit der 9. Sinfonie, dem Lied von der Erde und der vollständigen Version der 10. Sinfonie - in der Fassung von Deryck Cooke - fortgesetzt und schließlich mit der monumentalen 8. Sinfonie abgeschlossen.
Sie haben intensiv mit der Staatskapelle gearbeitet. Gibt es Punkte, wo Sie sagen, Sie müssen die Arbeit verändern oder nachjustieren?
DG: Nein, es geht vielmehr auch darum, weniger gespielte Komponisten und Werke gemeinsam neu zu entdecken. Mahler war in den vergangenen Spielzeiten der Staatskapelle nicht so präsent, und soweit ich weiß, wurde seine 7. Sinfonie noch nie von der Staatskapelle aufgeführt. Natürlich ist das musikalische Niveau der Musikerinnen und Musiker so hoch, dass sie sofort den Geist dieser Werke erfassen.
Zudem haben wir gerade den Schumann-Zyklus abgeschlossen – im Juni folgt noch die Dritte Sinfonie. In der nächsten Spielzeit werden wir außerdem ein Programm präsentieren, das sich ganz der französischen Musik widmet. Es ist für jedes Orchester essenziell, sich mit diesem Stil und dieser besonderen musikalischen Schule auseinanderzusetzen, insbesondere mit Claude Debussy. Ich empfinde große Freude an dieser Zusammenarbeit.
In der Semperoper und für die Kapelle gelten Wagner und Strauss quasi als Säulenheilige, Sie werden Werke der beiden im 3. Sinfoniekonzert aufführen - und obendrein die erste sowie die letzte Opernpremiere der Spielzeit leiten: Verdis »Falstaff« und Wagners »Parsifal«. Welchen Bezug haben Sie zu diesen zwei »letzten Werken«?
DG: Diese beiden Komponisten sind zentrale Figuren der Romantik und deutschen Spätromantik. Wagner liegt mir besonders am Herzen. Ich hatte das Glück, Parsifal in Bayreuth zu dirigieren sowie Werke wie Lohengrin, Tristan und Isolde und Die Meistersinger von Nürnberg. Als italienischer Dirigent stehe ich somit in der Tradition großer Landsleute wie Arturo Toscanini oder Angelo Mariani, dem herausragendsten italienischen Dirigenten am Ende des 19. Jahrhunderts, der Wagner als Erster nach Italien brachte, genauer gesagt, nach Bologna. Toscanini, Victor de Sabata und Giuseppe Sinopoli haben bleibende Spuren in der Wagner-Interpretation hinterlassen. Natürlich bringen wir als Italiener einen eigenen Zugang mit – aber das bedeutet nicht, dass er sich grundlegend von der deutschen Tradition unterscheidet. Die Staatskapelle Dresden ist somit eine Schatzkammer der deutschen Musiktradition, und doch bleibt es unsere Aufgabe als Dirigenten, die Partituren zu erforschen und ihre verborgenen Botschaften hinter den Noten zu entschlüsseln. Dasselbe gilt für Strauss, der eng mit Dresden verbunden ist. Für mich ist es eine Ehre, mich der Interpretation dieser Komponisten zu widmen.
Wir werden Strauss und Wagner im 3. Sinfoniekonzert hören. Ist es etwas besonderes für Sie, diese Komponisten mit der Staatskapelle zu spielen?
DG: Ja, dieses sehr sichtige Programm widmet sich der Figur des Helden. Die von mir zusammengestellte Auswahl aus der Götterdämmerung hebt die Figur des Siegfried hervor, während Strauss sich in Ein Heldenleben selbst als künstlerischen Helden darstellt. Beide Werke haben neben rein visuellen und technischen Unterschieden eine nahezu identische Orchesterbesetzung. Dieses Programm werden wir auch auf Tournee präsentieren – ein bedeutendes Aushängeschild für die Staatskapelle. Wenn wir international auftreten, achten wir stets darauf, Programme zu wählen, die die Identität dieses traditionsreichen Orchesters widerspiegeln. Im November werden wir auf unserer China-Tournee Mahlers 5. Sinfonie und Ein Heldenleben aufführen – Werke, mit denen sich die Staatskapelle im Ausland als Botschafterin der deutschen Kultur präsentiert.
In der ersten Saison haben Sie keine Oper dirigiert, in der zweiten werden Sie »Falstaff« und Wagners »Parsifal« dirigieren. Welchen Bezug haben Sie zu diesen zwei »Letzten Werken«?
DG: Ich wollte mich in der ersten Saison ganz auf die sinfonische Arbeit konzentrieren. Auch wenn ich als Chefdirigent der Staatskapelle in der Semperoper Operndirigate übernehme, bin ich dort dennoch ein Gast. Parsifal hat meine Opernkarriere dank der Festspiele in Bayreuth entscheidend geprägt. Falstaff hingegen begleitet mich seit meinen Studienjahren am Konservatorium. Mit der Wahl dieser beiden letzten Werke von Verdi und von Wagner - den beiden großen Komponisten, die mir am nächsten stehen - glaube ich, meinen Stil als Operndirigent mit dem Dresdner Orchester hervorheben zu können. Sie sind grundverschieden: Parsifal ist fast eine metaphysische Oper, während Falstaff eine bittersüße Komödie ist. Man darf Falstaff nicht als Opera buffa bezeichnen – es ist eine Komödie mit tiefgründigen melancholischen Zügen. Man kann über Falstaff schmunzeln, aber nicht lachen.
»Tutto nel mondo è burla«, heisst es im »Falstaff«. Alles ist Spaß auf Erden - gilt das noch heute?
DG: Leider nein. Und ich glaube, das galt auch zu Verdis Zeit nicht. Verdi war ein Komponist, der oft von düsteren Gedanken und Bitterkeit geplagt wurde. Dass er sich im Alter ausgerechnet Falstaff als letztes Werk wählte, zeigt, dass es nicht nur eine lustige Burla ist, eine Posse. Diese Oper ist von Themen wie Nostalgie und Einsamkeit der Titelfigur geprägt. Falstaff ist nicht nur ein Schalk, sondern ein Mann am Ende seines Lebens, der noch einmal die Wärme der Gemeinschaft sucht. Man darf nicht vergessen, dass Falstaff ein Sir ist – ein Ritter, der einst Knappe war und eine angesehene Stellung innehatte. Doch das Leben hat ihn heruntergezogen. Man schaut mit Sympathie auf ihn – er ist ein liebenswerter Schelm, der sich seinem Lebensabend nähert. Die Oper Falstaff trägt die Farbe des Sonnenuntergangs – ein vergnügliches Spiel, aber mit melancholischem Unterton.
Im Gedenkkonzert 2026 verbinden Sie Strawinskys »Messe« mit Bruckners 9. Sinfonie - wie fügen sich diese beiden Kompositionen zueinander und wie sehr passen sie zu diesem Datum?
DG: Diese beiden Werke könnten stilistisch kaum unterschiedlicher sein. Genau dieser Kontrast war beabsichtigt – doch es verbindet sie etwas Wesentliches: Beide Komponisten waren tiefgläubig und der katholischen Religion eng verbunden. Auch wenn sich zwischen Strawinskys Neoklassizismus und Bruckners Verehrung für Johann Sebastian Bach gewisse Parallelen ziehen ließen, liegt mein Fokus auf einer anderen Ebene: Beide Werke sind letztlich Gott gewidmet. Bruckners 9. Sinfonie transportiert, obwohl rein instrumental, eine tief empfundene religiöse Botschaft. Bruckner wusste, dass er sich dem Ende seines Lebens näherte. Er widmete sie „dem lieben Gott“ und betete darum, seine Sinfonie vollenden zu dürfen – ein Wunsch, der ihm leider nicht erfüllt wurde. Strawinskys Messe hingegen stammt aus seiner neoklassizistischen Phase. Der gesamte Konzertabend ist somit ein zutiefst religiöses Programm, der aber nicht darauf abzielt, Gemeinsamkeiten zwischen den beiden musikalischen Stilen zu ergründen.
»Weltweit geschätzt, in der Semperoper zu Hause« lautet das Spielplanmotto der neuen Saison. Wie sehr ist der in aller Welt geschätzte Mailänder Daniele Gatti inzwischen in Dresden zu Hause?
DG: Ich genieße meine Zeit in Dresden sehr. Derzeit wohne ich im Hotel Kempinski, und meine Tage verlaufen zwischen dort und der Semperoper – mit Proben, Meetings, Vorspielen und allem, was mit meiner Aufgabe als Chefdirigent verbunden ist. Dresdens Stadtviertel lerne ich so erst nach und nach besser kennen. Kürzlich habe ich die Neustadt auf der anderen Elbseite entdeckt – ein Viertel, das ich vorher kaum kannte. Auch die Gegend unterhalb der Hügel mit ihren charakteristischen Häusern hat mich beeindruckt – diese Stadtteile möchte ich gern noch genauer erkunden. Sie liegen zwar etwas weiter vom Theater entfernt, haben aber ihren eigenen Reiz. Das Einzige, was mich sehr stört, ist die schwierige Erreichbarkeit von Dresden. Es gibt keine Direktflüge aus Italien oder Paris – man muss immer umsteigen, meist in München oder Frankfurt. Und wenn man eine Verbindung verpasst, ist der gesamte Reiseplan dahin. Ich fliege ohnehin nicht gern und meide Flughäfen, wo es geht. Deshalb fahre ich oft lieber mit dem Auto – auch wenn mich manche für verrückt halten, weil ich so viele Kilometer fahre. Aber das mache ich gern, denn es gibt mir die Freiheit, meine Reisen nach meinen eigenen Bedürfnissen zu gestalten.
Welche herausragenden Vorhaben haben Sie außerhalb von Dresden?
DG: Natürlich pflege ich weiterhin meine langjährigen Verbindungen – zu den Berliner Philharmonikern, zum Orchestre National de France, wo ich über acht Jahre Chefdirigent war und in Italien zur Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Auch bei den Wiener Philharmonikern, mit denen ich letztes Jahr die Saison eröffnet habe, werde ich 2027 das erste Abonnementkonzert dirigieren. Ich wähle meine Engagements inzwischen sehr bewusst aus. Manchmal brauche ich auch etwas Zeit für mich selbst – ich möchte nicht jeden Monat auf dem Podium stehen (lacht).